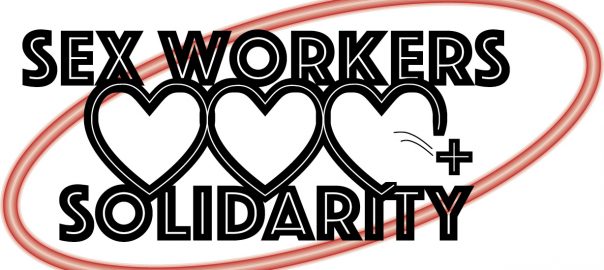Heute ist der internationale Hurentag – am 2. Juni 1975 besetzten mehr als 100 Prostituierte eine Kirche in Lyon, um gegen Gewalt, unaufgeklärte Morde und die Repression der Polizei zu protestieren.
Wir senden Grüße an die Parade in Berlin und freuen uns, zu diesem Anlass einen Text der Initiative Sex Workers Solidarity hier vorab veröffentlichen zu dürfen. Es ist ein Beitrag zum Sammelband “Feministische Perspektivne auf Sexarbeit”, der dieses Jahr im Unrast Verlag erscheinen wird.
ein feministischer Weg gegen Diskriminierung, schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung
Einleitung
Die Dresdner Initiative Sex Workers Solidarity war von Sommer 2017 bis Sommer 2018 aktiv. Anlass für die Gründung war die anstehende Verabschiedung und Implementierung des sogenannten Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), von der einige von uns persönlich betroffen waren. In Sachsen gab es zuvor weder Zusammenschlüsse von Sexarbeiter_innen noch Sprachrohre oder politische Fürsprecher_innen. Dementsprechend erhielten unsere Statements und Aktionen landes- und bundesweite Aufmerksamkeit. Dies lag sicherlich auch daran, dass unser inhaltlicher Standpunkt – eine Kombination gewerkschaftlicher und feministischer Perspektiven – sonst auf der öffentlichen Bühne kaum vorhanden war.
Wir möchten daher die Arbeit der Initiative nachzeichnen und unsere Überlegungen teilen, um sie im Gedächtnis emanzipatorischer Bewegungen zu verankern. Dazu beschreiben wir zunächst, was uns politisch wichtig war, dann was wir umsetzen konnten, und schließlich unsere Reflexionen und die daraus resultierenden Visionen für die Zukunft und Vorschläge an andere Initiativen.
Unsere Ausgangslage
Sex Workers Solidarity entstand als produktives Konglomerat aus Bekanntschaften einiger vom ProstSchG betroffenen Menschen, die in der basisdemokratischen Gewerkschaft Freie Arbeiter_innen Union (FAU) organisiert waren, mit Menschen aus feministischen Gruppen in der Stadt.
Die Sexarbeiter_innen in der Initiative nahmen eine große Verunsicherung bezüglich des Gesetzes und seiner Folgen wahr. Wir hofften, dass die drohende Repression gegen alle Sexarbeiter_innen als Anlass für Organisierung und Solidarisierung unter Kolleg_innen dienen könnte. Allerdings zeigten sich bald unterschiedliche Positionen: zum Beispiel zwischen besser und schlechter Bezahlten, zwischen erotischen Masseur_innen und Anbieter_innen von „richtigem Sex“, zwischen Sexarbeiter_innen mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft, zwischen den wenigen Menschen, die den Schritt in die Öffentlichkeit wagen und den vielen, die davor zurückschrecken.
Zudem existierte kaum Infrastruktur für Sexarbeiter_innen in Sachsen. Zwar gibt es gesundheitliche Beratung durch die Gesundheitsämter und Unterstützung von kobra.net e.V. für Opfer von Menschenhandel, aber keine Fachberatungsstelle zu den alltäglichen Problemen, auf die Sexarbeiter_innen häufig stoßen. Ein jährlicher runder Tisch von Stadt und Polizei fokussierte lediglich ordnungspolitische Probleme „mit der Prostitution“. Auch von einer organisierter Hurenbewegung war in Dresden nichts zu spüren, so dass wir eigene Strukturen aufbauen mussten.
Aus feministischer Sicht war die Ausgangslage allerdings auch ein Minenfeld: Die feministische Bewegung streitet sich seit Jahrzehnten immer wieder und zum Teil sehr erbittert darum, wie Sexarbeit insgesamt zu bewerten ist. Wie sollte sich die Initiative darin positionieren? Scheinbar gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder: Sexarbeit bedeutet Befreiung und wer anderes behauptet, ist verklemmt; jede Reglementierung ist Ausgeburt des Patriarchats und reaktionärer kirchlicher Sexualmoral. Oder: Prostitution ist immer Gewalt und schlimmste Ausgeburt des Patriarchats, und alle, die anderes behaupten, belügen sich selbst, leiden am Stockholm-Syndrom oder gehören gar zu den Profiteur_innen der frauenverachtenden Ausbeutung. Selbst Positionen, die keinem dieser Extreme entsprechen, werden schnell von außen in eine dieser Schubladen eingeordnet. Wir versuchten daher, die Schlagworte beider „Lager“ zu vermeiden, um zum eigentlichen Thema vorzustoßen: der Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Sexarbeiter_innen.
Dennoch brauchten wir für unsere öffentliche Kampagne einen gemeinsamen politischen Standpunkt, um nicht in Oberflächlichkeit und Ziellosigkeit zu enden. Wir einigten uns auf Folgendes: Wir wollen weder Sexarbeit pauschal dämonisieren, noch aus Angst vor Überwachung und Kontrolle dem neoliberalen Dogma folgend alles als selbstbestimmt und frei aushandelbar darstellen. Denn Letzteres sichert das reibungslose Funktionieren des Marktes und damit die Gewinne jener, die von der Ausbeutung von (überwiegend) Frauen und trans Menschen profitieren. Stattdessen betonen wir objektive Interessengegensätze zwischen Chef_innen und (Schein‑)Selbstständigen, beziehungsweise zwischen Vermieter_innen und Mieter_innen.
Insgesamt schien uns in der Gemengelage von Stigmatisierung und staatlicher Diskriminierung ein breiter feministischer und gewerkschaftlicher Ansatz für selbstbestimmte Kämpfe einer tendenziell prekarisierten Gruppe am besten geeignet. Auch während unserer Aktivitäten und später im Rückblick haben sich für uns daran keine Zweifel ergeben – vielmehr sahen wir uns immer wieder darin bestätigt.
Wie wir aktiv geworden sind
In dieser komplexen Lage und mit diesen miteinander verwobenen Ansprüchen haben wir im Sommer 2017 über einige Wochen überlegt, mit welchen Strategien und Möglichkeiten wir darauf reagieren können. Dabei waren einige Fallstricke zu umgehen:
Durch die geplanten repressiven Gesetze, die auch die Hemmschwelle erhöhten, zu unseren Treffen zu kommen, wollten viele Betroffene erst recht anonym bleiben. Als Antwort darauf hielten wir einen Zusammenschluss von Sexarbeiter_innen und Unterstützer_innen / Freund_innen für sinnvoll. Der Gruppenname „Sex Workers Solidarity“ erlaubte es, Anonymität und Sichtbarkeit zu vereinen.
Zudem galt es, den Spagat zwischen kurzfristiger Reaktion auf die fortgeschrittenen Gesetzespläne und nachhaltiger Organisierung zu meistern. Wir wollten die Implementierung beeinflussen, aber auch längerfristig einen Austausch über Rechte, Arbeitsbedingungen und kollektive Wege der Verbesserung anstoßen, um Solidarität statt Abgrenzung gegeneinander voranzutreiben.
Anfangs gab es zudem die Überlegung, die Kampagne für Rechte von Sexarbeiter_innen mit emanzipatorischen Angeboten zu sexueller Bildung zu verknüpfen (z.B. Workshops zum Sprechen über Körperteile oder über Sex, zum Grenzen-Setzen oder zur Vulva-Massage, oder über Hurendiskriminerung). Sexarbeiter_innen sollten nicht ausschließlich als Opfer von Sexismus oder als Objekte von behördlichen Maßnahmen auftauchen, sondern selbst als Expert_innen sprechen. Diese Überlegung haben wir allerdings vorerst hintangestellt, um die positiven Aspekte der Sexarbeit nicht zu stark in den Vordergrund zu rücken und ihre gesellschaftlichen Verstrickungen zu verdecken.
Insgesamt hat sich dann in der Praxis eine Art Drei-Säulen-Konzept ergeben:
- Druck auf Politik, Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess, z. B. durch Öffentlichkeitsarbeit,
- Informationsbeschaffung und -weitergabe an Betroffene,
- Möglichkeiten zu Austausch und langfristiger Selbstorganisation, gegen Repression und für bessere Arbeitsbedingungen.
Praktische Erfahrungen und Reflexion
Uns war bei all dem wichtig, die Stimmen der Sexarbeiter_innen in den Mittelpunkt unserer Kampagne zu stellen. Das bedeutete, dass wir uns viel Zeit dafür genommen haben, über die Grenzen des eigenen Blickfeldes zu reflektieren und uns mit den verschiedenen Positionen zu Sexarbeit bzw. Prostitution und Arbeit auseinanderzusetzen.
Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit war außerdem die Vernetzung: z.B. mit dem Gesundheitsamt Dresden, kobra.net e.V., Einzelpersonen des Berufsverbands sexuelle und erotische Dienstleistungen (BesD), FAU-Strukturen oder einzelnen sächsischen Politiker_innen.
In Sachsen haben wir öffentlich das Gesetz und die Folgen für Sexarbeiter_innen kritisiert. Gleichzeitig informierten wir auf einer Facebookseite über den neuesten Stand des Gesetzes. Einige Kolleg_innen halfen beim Übersetzen in andere Sprachen. Wir führten mehrere Infoveranstaltungen in Dresden durch und stellten uns für Interviews zur Verfügung. Schnell wurden wir als Ansprechpartner_innen für das Thema wahrgenommen, sowohl in Dresden als auch von außerhalb. Von Seiten der Medien gab es großes Interesse an „Betroffenen“, das wir aus Anonymitäts- oder Überlastungsgründen nicht immer befriedigen konnten oder wollten.
Mit dem Sächsischen Landtag verband uns eine vielseitige Auseinandersetzung: Wir leakten und kommentierten den Gesetzesentwurf, besuchten mit vielen Menschen eine öffentliche Anhörung und begleiteten diese mit einer Kundgebung und schrieben einen Offenen Brief an alle Landtagsabgeordneten. Mit unseren Beiträgen haben wir öffentlichen Druck erzeugt und zusammen mit anderen ziemlich starken Einfluss genommen. Z.B. wurden die Gebühren für die Registrierung und Zwangsberatung erheblich gesenkt. Schlussendlich bedachten wir die Landtagssitzung zum SächsProstSchGAG1 mit einem Regen aus Hurenpässen2, die wir personalisiert auf die Abgeordneten ausgestellt hatten. Diese Aktion setzte einen fulminanten Schlusspunkt unter unsere Kampagne zum Gesetz und bescherte uns lustige Zeitungsüberschriften und bundesweite Zustimmung aus der Hurenbewegung.
Einige Zeit später setzten wir uns nochmal zusammen, um einen Auswertungstext zu schreiben. Selbst ein Jahr später erreichten uns weiterhin Anfragen für Podiumsgespräche.
Solidarität und Abgrenzung
Neben der Wirkung nach Außen hat unsere Arbeit einzelne Mitglieder der Gruppe auch individuell weitergebracht: Die Initiative gab aktiven Sexarbeiter_innen Raum, um über ihre Arbeit zu sprechen und Unterstützung und Solidarität zu erfahren. So wurde es möglich, eigene Probleme in einem größeren Zusammenhang zu begreifen, damit nicht allein zu sein und zu erleben, dass gemeinsames (politisches) Handeln tatsächlich etwas bewirken kann – dass es einen Unterschied macht, ob wir den Mund aufmachen oder nicht.
Selbstkritisch bleibt anzumerken, dass auch wir nur in bestimmte Bereiche der Branche Einblick hatten, vor allem in deutschsprachige, nicht ganz so prekäre. Die Kontaktaufnahme zu anderen Bereichen mit härteren Arbeits- oder Lebensbedingungen hätte viel mehr Zeit und Einsatz gebraucht, wäre aber auch grundlegend für eine übergreifende, solidarische Organisierung gewesen. Zudem hatten wir mit dem Widerspruch zwischen dem Anspruch eines nachhaltigen Strukturaufbaus und Kampagnenaktivismus unter Zeitdruck zu kämpfen.
Austausch und Selbstorganisation
Neben diesen nach außen wirkenden Ergebnissen unserer Arbeit haben wir auch einiges erreicht, was die einzelnen Mitglieder der Gruppe in der ein oder anderen Form individuell weitergebracht hat: In der Initiative haben aktive Sexarbeiter_innen einen Raum gefunden, der ihnen die Möglichkeit gab, über ihre eigene Arbeit zu sprechen und darin Unterstützung und Solidarität zu erfahren. Die Gruppe hat es mit ihrer Ausrichtung möglich gemacht, eigene Unsicherheiten und Probleme in einem größeren Zusammenhang zu begreifen, damit nicht alleine zu sein und sich nicht einschüchtern zu lassen. Sie hat erfahrbar gemacht, dass gemeinsames (politisches) Handeln tatsächlich etwas bewirken kann – dass es einen Unterschied macht, ob wir den Mund aufmachen oder nicht.
Selbstkritisch bleibt anzumerken, dass auch wir nur in bestimmte Bereiche der Branche Einblick hatten, vor allem die deutschsprachigen, nicht ganz so prekären. Die Kontaktaufnahme zu anderen Bereichen, in denen härtere Arbeits- oder Lebensbedingungen es schwieriger machen, hätte viel mehr Zeit gebraucht und viel Arbeit gekostet, wäre aber auch wichtig für eine übergreifende, solidarische Organisierung gewesen.
Außerdem ist die zusätzliche Belastung durch repressive Gesetze und Behörden nicht zu unterschätzen. Viele Sexarbeiter_innen sind dadurch erst recht eingeschüchtert und wollen erst recht anonym bleiben. Dadurch wurde sicher auch die Hemmschwelle noch erhöht, zu einem Treffen zu kommen.
Nicht zuletzt hatten auch wir mit dem Widerspruch zwischen dem Anspruch eines nachhaltigen Strukturaufbaus und Kampagnenaktivismus unter Zeitdruck zu kämpfen.
Differenzierte Diskussionen
Wir haben uns in der Diskussion um Sexarbeit vs. Prostitution um eine möglichst differenzierte Betrachtung bemüht. Im Großen und Ganzen erhielten wir viele positive Rückmeldungen für unsere Position. Zugleich unterschied sich unsere Haltung von anderen, zum Beispiel von der des Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen (BSD), der mit seiner wirtschaftsliberalen Ausrichtung und als Lobbyverein von Bordellbetreiber_innen nur so lange die Belange der dort Beschäftigten berücksichtigt, wie diese nicht im Widerspruch zu den Interessen der Betreiber_innen und Kund_innen stehen.
Auch haben wir etwas andere Punkte betont als der BeSD in seiner Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung von Sexarbeiter_innen. Er legte den Fokus vor allem auf Entstigmatisierung, Networking und professionellen Austausch, während wir stärker das Ziel der (Selbst‑)Organisierung am Arbeitsort hochhielten. Mit seinen Positionen erreicht der BeSD strukturell vor allem sozial und ökonomisch besser gestellte Sexarbeiter_innen. In der öffentlichen Debatte wurde dieser Sachverhalt wiederholt von Politiker_innen und Kritiker_innen angeführt, um die Forderungen des BeSD abzuwehren, weil diese von Privilegierten kämen. In dieser Form entlarvt sich vermeintliche Kritik als Hurendiskriminierung.
Es bleibt die Frage, wie die Themen von Sexarbeiter_innen, die weniger Geld und Zeit haben oder mehr Angst haben, ebenfalls Gehör bekommen – doch diese Frage richtet sich nicht allein an die Interessenvertretung von Sexarbeiter_innen, sondern noch stärker an Medien und Politik.
Mit all diesen Fragen wird wohl jeder Versuch der Organisierung in der Branche umzugehen haben, wenn es um gute Arbeits- und Lebensbedingungen und nicht nur um eine wirtschaftsliberale Abwehr staatlicher Regulierung gehen soll. Ein Schritt dabei sind die – auch im BeSD geführten – Diskussionen um die Verwobenheit mit verschiedenen Herrschaftsdimensionen und Bemühungen um größere Diversität.
Forderungen und Ideen für die Zukunft
Zu weiteren politischen Maßnahmen, die Sexarbeiter_innen im Gegensatz zum ProstSchG tatsächlich schützen, zählen eine Stärkung von Selbstbestimmung, Arbeitsrechten und Beratungsangeboten. Dies kann nicht allein ehrenamtlich geleistet werden. Daher haben wir die Einrichtung bzw. den Ausbau unabhängiger, anonymer, niedrigschwelliger und mehrsprachiger Fachberatungsangebote gefordert, unter anderem zu den Themen Arbeitsrecht und sexualisierte Gewalt. Besonders wichtig ist aus unserer Sicht auch der Bereich Streetwork, insbesondere um den Zugang zu Gesundheitsdiensten für Menschen ohne Krankenversicherung oder geregelten Aufenthaltsstatus zu erleichtern. Die materielle Absicherung, insbesondere von Migrant*innen, muss sichergestellt werden. Weiterhin müssen Bildungsangebote wie Deutschkurse, berufliche Aus- und Weiterbildungen oder Selbstverteidigungskurse geschaffen werden. Der mindeste Schritt dahin wäre die grundlegende Überarbeitung des ProstSchG anhand der Perspektiven und Wünsche der unterschiedlichen Betroffenen, die bislang komplett ignoriert wurden.
Ganz wichtig ist die Selbstorganisation und der Austausch unter Kolleg_innen. Dazu bräuchte es in jeder Stadt Treffpunkte, z. B. regelmäßige Hurenstammtische. Damit diese auch von verschiedenen Leuten besucht werden, müssten Kontakte zu Arbeitsorten aufgebaut werden, ohne über die Betreiber_innen zu gehen, und auch unabhängig von staatlichen Stellen. Irgendwann könnte die Vernetzung so stabil sein, dass man gemeinsam mit allen Kolleg_innen – ohne Arbeitgeber_innen – besprechen kann, wie man arbeiten will, wie viel sexuelle Dienstleistungen kosten sollen und unter welchen Bedingungen sie überhaupt angeboten werden sollen. Damit das Gespräch über solche Fragen nicht abbricht, können gemeinsame Strukturen, beispielsweise Betriebsgruppen gegründet werden.
Dies sollte inklusiv und solidarisch mit allen Kolleg_innen stattfinden, ohne rassistische Abgrenzungen oder solche zwischen verschiedenen Bereichen der Branche. Dazu können bereits existierende Strukturen genutzt werden, wie der BeSD oder die branchenübergreifende basisdemokratische Gewerkschaft FAU. Auch ein Blick in andere Länder wie Spanien ist inspirierend, wo Kolleg_innen in der Sexarbeiter_innen-Gewerkschaften OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) ihre Interessenvertretung seit 2018 selbst in die Hand nehmen.
Ein weiteres Feld für einen positiven gesellschaftlichen Wandel sind Workshops zur sexuellen Bildung, z.B. zum Sprechen über Körperteile oder über Sex, zum Grenzen-Setzen oder zur Vulva-Massage. Noch viel zu selten gibt es solche Bildungsangebote, die vielen Menschen in Beziehungen und Sexualität nützen würden. Auch kritische Vorträge und Trainings gegen Hurendiskriminierung sind wichtig. Solche Veranstaltungen können von Sexarbeiter_innen angeleitet werden, wobei sie als Expert_innen und nicht als Objekt von Stigmatisierung agieren.
Ein Schlusswort
Grundsätzlich müssen wir uns mit den gesellschaftlichen Ursachen der Probleme in der Sexarbeit auseinandersetzen, statt weitere, meist diskriminierende und stigmatisierende Regelungen einzuführen. Nicht Sexarbeiter_innen müssen bekämpft werden, sondern Armut, Rassismus, hierarchische Geschlechterverhältnisse und ungleich verteilte Bildungs- und Arbeitsangebote. Auch der Kampf gegen Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung darf nicht vergessen werden.
Die Abwertung und Stigmatisierung von Sexarbeiter_innen kann nicht allein auf staatlicher Ebene überwunden werden, sondern muss in der gesamten Gesellschaft bekämpft werden. Mit einer starken Hurenbewegung im Rücken können Sexarbeiter_innen ihre Anliegen demonstrierend auf die Straße und in Rathäuser und Parlamente tragen. Wir brauchen Kolleg_innen, die ‚Gesicht zeigen‘, die auch diejenigen vertreten, die dazu nicht in der Lage sind – und dafür kämpfen, dass bald alle diesen Schritt gehen können.
Wir setzen auf den solidarischen Austausch mit feministischen, queeren und gewerkschaftlichen Bewegungen, damit Sex Workers nicht allein für ihre Forderungen einstehen müssen. Auch mit auf den ersten Blick politisch entfernt erscheinenden Ansätzen wie „Recht auf Stadt“-Bündnissen oder Mietprotesten gibt es wichtige Gemeinsamkeiten, die unter einem intersektionalen Blickwinkel zu vereinten sozialen Kämpfen zusammengeführt werden können. Praktische und theoretische Ansatzpunkte ergeben sich sowohl in älteren Debatten wie der um Sorge-, Haus- und Care-Arbeit, als auch in neueren Anläufen wie der internationalen feministischen Streikbewegung. Es müssen Brücken geschlagen werden zwischen den Erfahrungen von Sexarbeiter*innen und Ehefrauen, Putz- und Pflegekräften. Die konkreten Tätigkeiten und die Formen der Abwertung überschneiden sich stark – die Solidarisierung miteinander liegt auf der Hand.